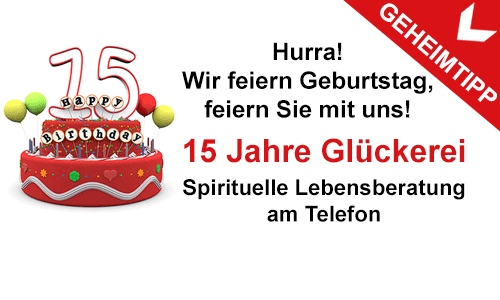Wenn Barbara Pachl-Eberhart auf die paar Tage zurückschaut, die gerade hinter ihr liegen, hat sie ganz schön viel Auswahl. Überhaupt staunt sie, wie groß die Auswahl ist. Denn die „paar Tage“, auf die sie zurückschaut, könnten gestern und vorgestern sein. Oder die letzte Woche. Der vergangene Monat, das vergangene Jahr.
Oder mein bisheriges Leben – „ein paar Tage“ ist ja höchst relativ. Ich kann wählen, worauf ich schaue. Aber das ist noch nicht alles. Ich kann auch noch auswählen, wie. Schaue ich mit dem Fernrohr oder mit der Lupe? Schaue ich lächelnd oder mit der Stirnfalte, die ich immer bekomme, wenn ich mich konzentriere? Schaue ich auf Menschen, auf mich, auf Dinge, Projekte, Erlebnisse oder Erfolge? Schaue ich auf das, was fertig wurde oder auf das, was gerade offen ist? Auf das, was schön war oder auf das, was mich wurmt? Möglich ist alles. Oder besser: fast alles. Eines geht nämlich nicht: auf alles auf einmal zu schauen. Beziehungsweise: mich nicht zu entscheiden. Mehr noch als das Schwelgen in Worten, Erlebnissen und konkreten Details, genieße ich beim Schreiben dieser Kolumne eben dieses Prinzip. Dass sie mich zu einer Entscheidung zwingt. Dass sie mir verbietet (oder ich mir verbiete), über irgendwas zu schreiben, ohne zu wissen, was es ist. Über irgendwas will ich nicht schreiben, denn allzu leicht passiert da ein Buchstabendreher, ein Tausch. Kleines g gegen r. Irrendwas.
Irrend, was. Die Entscheidung, die ich treffe, ehe ich mich vertiefe, hilft mir, mich nicht zu verirren, in der Vielfalt der Möglichkeiten. Um dann, im selbst gesteckten Rahmen sicher zu sein, tief zu tauchen, wild zu spielen und nach Herzenslust umherzustreunen. Mein Mann Heli fällt mir ein. Er spielte einmal den Clown in einem Schwimmbad. Aus Übermut sprang er, improvisierend, ganz ungeplant, in den Badeteich. Tauchte. Spielte ertrunken, versteckte sich unter Wasser, so lange es ging. Freute sich auf das Lachen der Kinder, wenn er gleich prustend auftauchen würde. Und merkte plötzlich, erschrocken, dass da etwas Hartes war. Keine Luft, kein Platz für seinen Kopf, sondern Holz. Auftauchen unmöglich. Er hatte sich vorher nicht orientiert und war, ohne sein Wissen, unter einen Steg getrieben, der die Oberfläche des Wassers bedeckte. Fast wäre Heli ertrunken. Fast hätte ich ihn nie kennengelernt. Fast wäre er nicht zu früh, sondern viel, viel zu früh gestorben. Fast wäre mein Leben, ohne ihn, ohne das Wissen um ihn, ganz anders verlaufen. Schreiben ist auch eine Art zu tauchen. Man springt. Verlässt die Oberfläche. Macht sich bereit, den Boden, den sicheren Standpunkt aufzugeben. Was sieht man, da unten? Gar nichts, wenn man keine Brille aufhat. Viel Neues, wenn man die Brille trägt. Die Entscheidung, die ich treffe, ist meine Brille. Welche will ich aufsetzen, wenn ich Rückschau halte, auf die, sagen wir, letzten zwei Tage? Ich wähle eine, die mir heute Früh eingefallen ist. Sie hat etwas mit der Art zu tun, wie ich hier schon so lange über Wunder schreibe.
Meistens nämlich so:
Ich berichte von einem Wunder, das mir begegnet ist. Genauer: von einem, das mich erwischt, überrascht oder am Schopf gepackt hat. Meistens ist es so, dass das Wunder auf mich zukommt. Meistens suche ich nach den Momenten, in denen es so war. Auch heute könnte ich solche Momente erinnern. Zum Beispiel den Moment, als ich gerade eine Frage in mein Tagebuch geschrieben hatte – und eine Minute später eine WhatsApp meiner Freundin kam, in der sie mir (ohne es zu wissen) meine Frage beantwortete. Oder den Moment, in dem mein Kind beinahe wörtlich ein ganzes Bilderbuch rezitierte. Eines, das wir erst drei Mal gelesen haben. Vor mehr als zwei Wochen. Oder … nein. Heute will ich es ja anders machen. Ich will nicht auf die Wunder schauen, die mir entgegengekommen sind. Ich will die Richtung wechseln. Welchen Dingen habe ich mich wundernd zugewandt? Was habe ich be-wundert, sodass es zum Wunder werden durfte, überraschend, für einen Moment? Wunder entstehen nicht im luftleeren Raum. Es gibt sie nicht ohne Beziehung. Nicht ohne Empfänger. In letzter Zeit habe ich mich oft aktiv um Beziehungen bemüht. Ich war die, die anrief, schrieb, einlud. Es war schön, Antwort zu bekommen, ein „Danke, dass du an mich denkst“. Freundschaft wird belebt, wenn man in Beziehung tritt. Wunder werden lebendig, wenn man Schritte macht, aufeinander zu. Was also habe ich bewundert, in den letzten paar Tagen? Die Essays von Joyce Maynard. Das Buch „Über Menschen“ von Juli Zeh. Meine schlafende Tochter. Und, ganz
bewusst, meine Tochter inmitten eines Wutanfalls. Was noch? Die Art, wie meine Freundin mit ihrer Tochter sprach. Und dann noch (als ich das mit dem Be-wundern bewusst beschlossen hatte): ein Straßenschild. Den ersten Satz einer Bruckner-Sinfonie. Die Freundlichkeit einer Beamtin am Telefon. Und die Tatsache, dass ich heute aufgewacht bin. Ich mach dann mal weiter, mit dem Bewundern. Und freue mich auf das nächste Mal, bei dem ich über dieses oder jenes Wunder erzählen darf. Bis dann, bis ganz bald.
 Barbara Pachl-Eberhart, 39, war Clown. Sie hat bei einem Zugunglück ihre beiden kleinen Kinder und ihren Mann verloren. Mit beeindruckender Kraft fand sie ins Leben zurück und schrieb über ihre Tragödie einen Bestseller („Vier minus drei“). Heute lebt sie als spiritueller Coach und als Schriftstellerin in Wien. Für das ENGELmagazin geht sie auf die Suche nach den kleinen Wundern des Alltags. www.barbara-pachl-eberhart.at
Barbara Pachl-Eberhart, 39, war Clown. Sie hat bei einem Zugunglück ihre beiden kleinen Kinder und ihren Mann verloren. Mit beeindruckender Kraft fand sie ins Leben zurück und schrieb über ihre Tragödie einen Bestseller („Vier minus drei“). Heute lebt sie als spiritueller Coach und als Schriftstellerin in Wien. Für das ENGELmagazin geht sie auf die Suche nach den kleinen Wundern des Alltags. www.barbara-pachl-eberhart.at